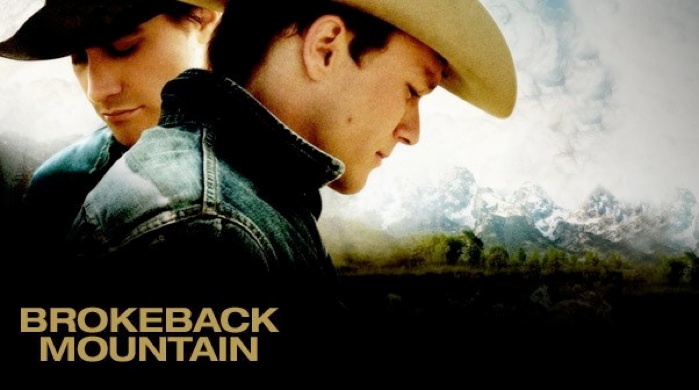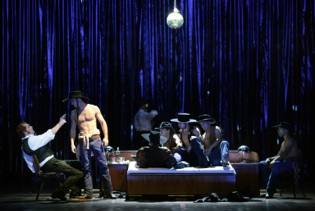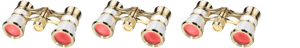Foto: © Paramount Pictures / Regie: Ang Lee, Hauptrollen: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal; Alle Rechte vorbehalten
Tchaikovskys Eugen Onegin
in der Bayerischen Staatsoper
3 von 5 Operngläsern
Prädikat: Sehenswert!
Broke Back Mountain goes St. Petersburg
oder: Der Schwule als Überflüssiger Mensch
Der Schwule an sich gehört zur Oper wie der Gong zur Pause.
Wieso das so ist? Das liegt wohl tief im Wesen des Homosexuellen verwurzelt:
Er liebt die mitreißende Musik, das Drama an sich, die Träumerei, das Verzweifelte...
Eine Fantasiewelt, in der er sich für ein paar Stunden ergehen darf.
Als der polnische Regisseur Krzysztof Warlikowski seinen Eugen Onegin
an die Bayerische Staatsoper brachte,
war vorhersehbar, dass es Kritik hageln werde.
Eine schwule Inszenierung à la „Brokeback Mountain“,
Ang Lees Kinofilm, in dem zwei Cowboys mitten im ur-männlichen Milieu
des spießigen Amerikas Gefühle füreinander entwickeln?
Hilfe, die Schwulen erobern die Oper!
Das Hetero-Establishment sieht sich nicht gerne gestört von
homosexuellen Themen. Dafür gibt es ja jedes Jahr den „Christopher Street Day“,
diese Parade, zu der kreischende Tunten bunte Kostüme anziehen und sich
in der Öffentlichkeit präsentieren dürfen.
Schlimm genug...
So lautet unser Lieblings-Zitat eines Kritikers, Christoph Schmitz:
„...Ein schwuler Regisseur vergewaltigt eine heterosexuelle Oper. So könnte man auf den Punkt bringen, was in der Bayerischen Staatsoper gestern Abend mit Tschaikowskys "Eugen Onegin" geschehen ist.“
(Christoph Schmitz, Deutschlandfunk)
Noch weniger einfühlsam kann man kaum mit dem Thema der
Homosexualität umgehen. Zum Verständnis muss man wissen,
dass Tchaikovsky selber schwul war. Das ist nunmehr,
rund 120 Jahre nach seinem Tod kein Geheimnis mehr.
Geboren 1840 im Ural war das für den Komponisten aber
sicher kein leichtes Schicksal. Mehr noch, Tchaikovsky
litt unter seiner „krankhaften Veranlagung“ und war Zeit seines Lebens
schwer depressiv. Einen kleinen Blick in seine vernarbte
Künstlerseele bieten die Umstände der berühmten Brief-Szene im ersten
Akt seines Onegin: Tatjana schreibt Onegin in einem Brief, dass er sie liebe.
Auch Tchaikovsky selbst erhielt so einen Brief während er den Onegin
komponierte, von seiner ehemaligen Schülerin, Antonia Miljukowa.
Die Briefszene hatte er bereits vertont, und sich mit der Figur Tatjana wohl
selbst identifiziert. Und, er haßte den Onegin, dafür wie er handelt, wie
er sein Leben verachtet, sich dem seelischen Müßiggang hingibt und letztendlich
an seinen Taten scheitern muss.
In dieser Situation schreibt seine Schülerin ein zweites Mal.
Und Tchaikovsky handelt, wie Onegin es nicht konnte:
Er macht der Antonia Miljukowa einen Heiratsantrag!
Man kann sich vorstellen, wie verzweifelt der homosexuelle Tchaikovsky
gewesen sein muss.
Bereit, eine Frau zu ehelichen, nur um sich von seiner Neigung zu „kurieren“,
nur weil die Gesellschaft ihn nicht akzeptieren möchte. Aber:
Der Versuch, seine Seele zu unterdrücken, muss in der Katastrophe enden.
Damals wie heute.
Und tatsächlich: Direkt nach den Flitterwochen beging Tchaikovsky
einen tragischen Selbstmordversuch.
Man muss sich also durchaus die Frage stellen,
wie viel von Tchaikovskys eigenen Seelenqual in seiner Onegin-Oper steckt.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Insofern hat der polnische Regisseur Warlikowski im Grunde das getan, was man von
einem Regisseur auch erwarten darf: Er hat das hervorgezerrt,
was der Komponist oder Autor eines Werkes – vielleicht manchmal sogar unbewußt –
zwischen den Zeilen, bzw. Noten, versteckt hat.
Es heißt doch immer, in jedem Roman stecke etwas Autobiographisches von seinem Autor.
Wieso sollte das bei einer Oper anders sein?
Dass Regisseur Warlikowski selber ebenfalls homosexuell ist,
trägt weniger zu einer Homo-isierung der Oper bei, wie es manche vermuten,
sondern öffnet der Regie vielleicht an manchen Stellen mehr das Herz,
als es ein heterosexueller Regisseur könnte. Nur wer selber unter seiner
Sexualität leidet kann tief nachempfinden,
in welcher schrecklichen Zerrissenheit Tchaikovsky seinen Onegin komponiert hat.
Versuchen Sie doch mal, auch heute noch im 21. Jahrhundert, in Polen schwul zu sein.
Ich bin sicher, der Regisseur Warlikowski hatte ebenfalls
Probleme mit seinem Outing in der Heimat.
Aber lassen Sie uns noch einmal den absolut seriösen Deutschlandfunk zitieren:
„... Weil jedoch Komponist und Regisseur homo sind, muss in der Logik Warlikowskis die ganze Theaterwelt homo sein...“
(Christoph Schmitz, Deutschlandfunk)
Nein, muss sie nicht.
Und das möchte diese bildstarke Inszenierung auch nicht vermitteln.
Schade, wenn Kritiker so wenig vom emotionalen Tiefgang eines Werkes mitbekommen.
Wie folgerichtig Warlikowskis Aufarbeitung des seelischen Dramas Tchaikovskys ist,
wie aktuell die Inszenierung auch heute noch, selbst im aufgeklärten München ist,
beweist auch das Münchner Publikum gerne. Man ist entsetzt, buht am Ende.
Nochmal: Schade.
Denn wer sich auf die Bilder – phänomenologisch wie psychologisch – einläßt,
erlebt eine große Oper, großartig umgesetzt.
Die Handlung wurde vom St. Petersburg
um 1820 versetzt in die prüden USA 1969.
Und Eugen Onegin ist latent, oder besser:
unterdrückt, homosexuell.
Er liebt Lenski, seinen Freund.
Und kann es doch nicht leben.
Stattdessen wendet er sich, wie es die
Norm von ihm verlangt, einer Frau zu: Tatjana.
Sie leidet wiederum an einer gewissen sozialen
Isolation, sie spürt, dass sie Onegins Herz nicht
erreichen kann. Es tut weh, ihre unerfüllte Liebe,
ihre emotionale Einzelhaft mitanzusehen,
am liebsten möchte man sie in den Arm nehmen
und ihr erklären, wieso Onegin sie nicht lieben kann.
Er meint es nicht böse!
Aber wie Onegin alleingelassen ist mit seiner seelischen
Qual, so erleben wir auch eine verletzte, zurückgewiesene
Tatjana, die die Welt nicht versteht (nicht verstehen kann).
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ;
Alle Rechte vorbehalten
Und die Welt, in der Onegin gerne frei leben würde, wird dem Publikum schonungslos serviert.
Nackte Männer-Oberkörper, die sich auf dem Bett räkeln, ein Cowboy-Ballett zur
Polonaise im dritten Akt, Tunten auf dem Ball des Fürsten Gremin. Immer sind es Männer,
die Onegin sieht, wenn er seine Tatjana anblickt. Er träumt sich davon, in eine andere
Welt. Und so setzt irgendwo im Hintergrund in einem Fernsehgerät die Apollo 11
zur Mondlandung an. Das kann man als Regie-Trick deuten, um klarzustellen, zu welcher Zeit die Handlung spielen soll. Oder man nimmt es als Symbol - die Mondlandung, der am 21.Juli 1969 die halbe Welt zuschauteund von fernen Welten und der Zukunft träumte.
Als sich Lenski und Onegin zum Duell treffen, ist es kein russisches, verschneites
Birkenwäldchen im Morgengrauen, sondern ein schäbiges Motel.
Die beiden sinken nebeneinander auf das Bett, und als sich der Schuß löst,
ist es die einzige Berührung Onegins mit seiner großen Liebe, zu der es kommt.
Der existenzielle Konflikt des Onegin,
seine Konfrontation mit sich selbst -
er wird nie, nie, nie glücklich sein können -
erfüllt den Teil des Publikums mit Trauer,
die bereit sind, sich auf Warlikowskis Inszenierung
einzulassen. Klar, man kann Eugen Onegin
weniger „anstößig“, anders, massenkompatibler
inszenieren. Die russische Seele der Musik
herausarbeiten, wie es meistens gemacht wird,
und sich in seine heterosexuelle Gemütlichkeit
zurücklehnen. Der tiefen Dramatik des Stückes
und des Komponisten wird man so aber wohl
nicht gerecht.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ;
Alle Rechte vorbehalten
Immerhin: Am Ende seines unglücklichen Lebens angekommen, so geht die „Legende“,
habe Tchaikovsky vom Zaren selbst den Befehl erhalten, seinem Leben und somit seiner
Liebe zu einem jungen Grafen ein Ende zu setzen. Er soll daraufhin ein verseuchtes
Glas Wasser getrunken haben um sich absichtlich mit Cholera zu infizieren.
Die offizielle Todesursache: Cholera.
Das unausgesprochene Leiden dieses großartigen Komponisten: Homosexualität.
Kann eine Liebe so schlimm, so verachtenswert sein, dass man sich deswegen umbringen muss?
An diesem Abend im 21. Jahrhundert mitten in München scheint es fast so...
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten