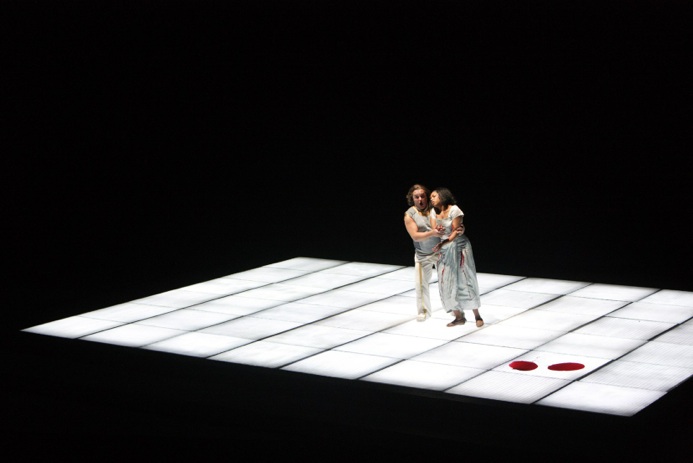Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Verdis Aida
in der Bayerischen Staatsoper
Regie: Christof Nel
5 von 5 Operngläsern
Prädikat: Großartig!

Die Architektur des Grauen(s):
Eine Aida ganz ohne Pharaonen-Kitsch
Persönliches Vorwort:
Manchmal ist es wie verhext. Ticken Kritiker und Premierenpublikum
anders als der Rest der Menschheit? Und wenn ja, dann elitärer, sprich
besser, und wir sind die Beschränkten? Oder verschränkt die Jagd
nach dem nächsten Aufreger den Blick auf das Besondere? Ein Psychologe
hat mir einmal erklärt, warum sich Senioren so oft über Kleinigkeiten
aufregen und dann mit Schirm, Stock und derber Sprache loswettern:
weil es einfacher ist, etwas Böses zu sagen, als etwas Nettes.
Wer etwas Nettes sagt, stößt eher bei der Gegenseite auf Abneigung,
als wenn er drauf los poltert. Klingt paradox, kann man aber tatsächlich
an sich selbst oft beobachten. Es kostet viel Überwindung, aufzustehen
und zu sagen: Moment mal, mir gefällt diese Aida aber außerordentlich
gut, auch wenn sich die Intelligenzia Münchens einig ist: Diese Aida
ist Schmarrn. Die Süddeutsche Zeitung nahm das Fazit des Premierenabends
seinerzeit gleich in der Schlagzeile vorweg: „Ein Buh für die Sterilität“.
Der Münchner Merkur schmähte hinterher: „Sündhaft verharmlost!“.
Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich diese Aida von Christof Nel
in München gesehen habe, war ich begeistert. Und die Menschen
im Publikum ebenso. Buhrufe? Habe ich nie gehört. Aber viel spontanen
Applaus, lange Ovationen am Ende und kräftige Bravo-Rufe, die sich
nicht nur auf das Können der Sängerinnen bezogen haben dürfte. Diese Aida
löst einfach große Gefühle aus. Sie berührt, verwirrt, zieht einen in den
Sog des Horrors wie ein klassischer, gut gemachter Horrorfilm. Aber, das
sagt einem ja schon die gute Erziehung: mit starrsinnigen Senioren
streitet man nicht. Man lässt sie schimpfen und geht seines Weges.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Die Inszenierung:
Laut Libretto spielt Aida in Ägypten, zur Zeit der Pharaonen. Das ist eine eher vage Zeitangabe,
die das Gros der Inszenierungen aber dazu bewegt, sich in Gottesstatuen, Palmwedeln,
Hieroglyphen und Pappmachee-Elefanten zu ergehen, bis das brave Klischee übervoll ist.
Die Alternative ist der gern genommene Versuch, die Geschehnisse um die äthiopische
Sklavin in andere Welten zu versetzen, etwa in ein modernes Familiendrama im heimischen
Wohnzimmer (Osnabrück), oder in Glanz und Kitsch einer Kolonial-Operette zur
Entstehungszeit 1871 (Zürich). Schwierig. Christof Nel hält dagegen mit dem äußerst begrüßenswerten
Versuch, die Aida zu entkitschen. Keine Elefanten, kein Pharaonen-Pomp, kein Kostümball.
Alles wird auf ein Minimum reduziert, Kulisse wie Kostüme, vor dem sich das Grauen der tragischen
Aida auf das brutalste entwickeln kann.
Wir befinden uns in einer Palastanlage, die räumlich nur per grauer Monolithen-Bauten andeutet.
Ein paar Hausecken, hier und da ein Tor, alles sehr nüchtern und graphisch.
Achja, und: alles in schmucklosem Grau.
Das gefällt uns von Opera Bavariae so gut, denn es lässt Raum
für die Fantasie. Soll heißen: In vielen Aida-Inszenierungen
(man denke nur an die großartige Maria Chiara auf DVD)
ergeht sich die Sklavin in rauschenden Roben mit Diadem,
Armspangen und der Attitude einer Primadonna.
Hmmm, unwahrscheinlich! Besinnt man sich auf die Fakten,
landet man doch eigentlich automatisch bei der Münchner
Interpretation: Die Sklavin hat sicherlich kein angenehmes
Leben in der Entourage der Amneris. Der Heimat entrissen
fristet sie ja wohl eher ein schreckliches, misshandeltes Dasein
ohne Glanz und Gloria. Dass sie sich frei nach dem
Stockholm-Syndrom in den Gegner Radames verliebt,
und im zweiten Akt von Amneris schmeichelnden Worten hinreißen
lässt erscheint um Meilen glaubhafter, wenn sie zuvor als
abgerissene, armselige Sklavin dargestellt wird. Betritt Amneris
die Szene in Gold und Make-up, wirkt die Aida daneben
verwahrlost, ungeschminkt, Mitleid erregend.
Das Los der äthiopischen Sklaven wird nicht romantisiert,
sondern erbarmungslos dargestellt.
Die sich fast ständig drehende Bühne offenbart immer wieder
den Blick auf Gruppen von Sklaven, die sich verängstigt in
Mauernischen drücken und wie Vieh gejagt werden.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Ein brachialer Höhepunkt der Aufführung ist das Gebet zu Ptah im ersten Akt, zweites Bild:
Nur allzu gerne ergehen sich Regie und Choreografie hier in einem üppigen, bunten Ballett,
wenn die Priesterin ihren Gott beschwört. Anders bei Nel: Die Szene verharrt in grausamer
Bewegungslosigkeit. Ein äthiopischer Sklave liegt auf den stufen des Tempels mit durchschnittener
Kehle und blutet aus. Die singende Priesterin kniet hinter ihm und hält seinen Kopf.
Nichts bewegt sich, das rote Blut spendet den einzigen Farbklecks in der Symphonie aus
Grau, Schwarz und Weiß. Die Musik entfaltet ihre volle Wucht und berührt den Zuschauer umso
mehr, auch ohne die sonst gewohnte Balletteinlage.
Die Priester stehen außenrum, in dieser Inszenierung dank aufregender Kostümierung ganz in
Schwarz zu dem reduziert, was sie eigentlich sind: Mörder, Aufrührer, Blutdürster. Weite schwarze Hosen,
ein Brustharnisch und ein Messer symbolisieren ihre perfide Kriegstreiberei. Genial.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Dass sich die Bühne fast pausenlos dreht, irritiert im ersten Akt noch ein wenig.
Das Auge kommt kaum zur Ruhe. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat,
erkennt man die gelungene Idee: Fast neugierig, was hinter der nächsten Häuserecke
zu sehen ist, wirkt die Drehbühne wie ein Spaziergang durch Memphis. Man erhält
voyeuristische Einblicke in das Leben am Pharaonenhof. Hier wird eine Sklavin vergewaltigt,
dort tanzen auf einem Platz die Adeligen zur Feier der siegreich heimkehrenden, dort
lauert Amonasro im Schatten, während eine Drehung weiter Aida sich mit Radames trifft.
Es ist, als hätten diese Wände Augen und Ohren, man ist der heimliche Beobachter
des höfischen Lebens und der Gräueltaten, die sich in dieser Aida ununterbrochen ereignen.
Dabei ist es nie zuviel, die Inszenierung ist keinen Augenblick überladen, lenkt nie ab.
Die Musik erreicht eine Intensität, die wir in vielen anderen Aida-Inszenierungen großer
Häuser vergeblich gesucht haben.
Foto: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper ; Alle Rechte vorbehalten
Erst im Schlußbild, Wenn Aida und Radames vereint in der Krypta sterben, wird die Dynamik des
Bühnenbildes aufgelöst. Die grauen Steinwände des Tempels entschweben in die Höhe, zurück
bleibt das unglückliche Liebespaar in der überwältigenden Schwärze des leeren Bühnenraums.
Nur ganz hinten, in der Distanz stehen aufgereiht die schwarzen Chormitglieder wie eine
unüberwindbare Wand aus menschlichem Versagen. Warum sich Aida zusätzlich die Pulsadern
aufgeschnitten hat, ist uns nicht ganz klar, aber wenn Tenor und Sopran einander in die Arme
sinken und ihr Leben aushauchen, hört man anders wie von den Kritikern des Premierenabends
behauptet keine Buh-Rufe, sondern vereinzelte Schluchzer aus dem Publikum. Es ist ein
erdrückend, anrührendes Schlussbild in schwärzester Dunkelheit.
Fazit:
In einer Zeit, in der Verdis exotische Oper zu einem Event verramscht wird, in immer größeren
Hallen mit enormer Material- und Protagonisten-Schlacht auf die Bühne geworfen wird –
wir erinnern uns hier zum Beispiel an Giuseppe Raffas Welttournee – ist diese Aida die purste,
klarste und schrecklichste. Einfach fantastisch!